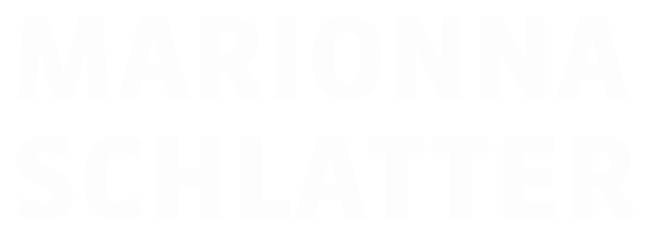Liebe Wetzikerinnen und Wetziker, liebe Gäste
Ich freue mich sehr, heute am 1. August hier in Wetzikon sprechen zu dürfen. Wetzikon – das ist für mich mehr als ein Ort auf der Landkarte. Es ist ein Stück Zuhause.
Meine Familie lebt hier, meine Eltern sind heute auch hier, viele Freundinnen und Freunde – und nicht zuletzt verbindet mich auch meine Tätigkeit als Pilzkontrolleurin mit dieser Stadt. Ja, Pilzkontrolleurin. Das klingt für manche vielleicht etwas altmodisch – für andere mysteriös. Ich sage immer: Ich bin die, die man fragt: „Kann man das essen – oder stirbt man davon?“
Und ich verspreche Ihnen: Ich rede heute nicht nur über Pilze, aber ein bisschen schon. Denn man kann aus dem Wald eine Menge über Demokratie lernen.
Ich bin hier geboren, aufgewachsen bin ich zuerst in Bäretswil. Mit 13 kam ich nach Wetzikon, vom kleinen Schulhaus mit altersdurchmischten Klassen an die grosse Kantonsschule. Für mich war das ein Kulturschock – im besten Sinn. Ich habe gelernt, dass es viele Perspektiven gibt. Dass man Regeln braucht, aber auch Freiräume. Dass Gemeinschaft nicht von allein funktioniert. Diese Fragen begleiten mich seither: Wie wollen wir zusammenleben? Wie gelingt Vielfalt? Was hält uns zusammen? Vielleicht war das der Moment, der mich später zur Soziologie geführt hat – und dann in die Politik.
Und heute stehe ich hier, um mit Ihnen über ein grosses Thema zu sprechen: über Demokratie. Ein Geschenk – das, wie Pilze – die richtigen Bedingungen braucht, um zu wachsen.
An die Demokratie haben wir uns gewöhnt wie an das saubere Trinkwasser aus dem Hahn. Aber Demokratie ist nicht einfach da. Sie ist nicht selbstverständlich. Das merken wir oft erst, wenn sie bedroht ist, oder wenn sie erodiert. Was heisst es eigentlich, in einer Demokratie zu leben? Heisst es, abstimmen zu können? Parteien zu gründen? Behörden zu wählen? Ja, auch das.
Aber es bedeutet noch mehr: Demokratie heisst, sich einzubringen. Sich zuzumuten. Mit anderen Menschen Verantwortung zu teilen – und Entscheidungen mitzutragen, auch wenn sie nicht immer bequem sind. Das ist das Privileg, das wir heute feiern. Und ich finde: Es ist eines der grössten, die ein Land seinen Bürgerinnen und Bürgern bieten kann. Sie ist wie ein Versprechen, das wir uns gegenseitig geben. Demokratie ist ein Gesellschaftsvertrag, den wir immer wieder erneuern – im Kleinen wie im Grossen. Im Umgang miteinander. In unserer Sprache. In der Art, wie wir zuhören – oder eben nicht.
Und dieses Versprechen wirkt tief in unseren Alltag hinein, oft unsichtbar, so wie das unterirdische Geflecht der Pilze, das den Wald am Leben hält. Das, was wir an der Oberfläche sehen – die Pilze, die aus dem Boden wachsen – ist nur ein Bruchteil. Das Entscheidende passiert im Verborgenen: ein riesiges Netzwerk an Pilzfäden, das Bäume miteinander verbindet, das Ressourcen teilt, das warnt, wenn ein Schädling kommt. Auch unsere Demokratie lebt von einem solchen unsichtbaren Netz: Vertrauen. Respekt. Verantwortungsgefühl. Wenn das beschädigt wird, dann nützen auch schöne Reden nichts mehr. Es ist wie bei den Pilzen: Wenn das unsichtbare unterirdische Netz stirbt, dann merkt man das vielleicht erst, wenn der Wald stirbt.
Sprechen wir über dieses Vertrauen. Zum Beispiel: der Schweizer Pass.
Warum ist es eigentlich so einfach, mit einem Schweizer Pass zu reisen? Mit dem Schweizer Pass kann man in sage und schreibe 187 Länder visumfrei einreisen. Damit gehört der CH-Pass zu den 5 attraktivsten Pässen weltweit. Während viele Menschen auf der Welt mit Hürden, Visaauflagen, Sicherheitskontrollen und Restriktionen kämpfen, können wir in 187 Länder einfach so einreisen; ohne lange Formulare, ohne besondere Begründungen, oft sogar ohne, dass jemand den Pass genau anschaut. Haben Sie sich auch schon gefragt, warum das so ist? Ich glaube, der Grund ist ziemlich banal: Alle Länder, in die wir reisen, sind sich sicher, dass wir wieder nach Hause zurück wollen. Weil uns vertraut wird. Nicht, weil wir netter oder moralischer wären. Sondern weil wir in einem Land leben, das als stabil und berechenbar gilt.
Weil wir ein System haben, das funktioniert. In dem Konflikte mit Argumenten ausgetragen werden. In dem Mehrheiten nicht einfach alles entscheiden. In dem Institutionen nicht gekauft werden können – und Kritik erlaubt ist.
Menschen flüchten in Demokratien. Wer flieht nach Russland oder nach China? Es gab noch nie in der Geschichte einen Krieg, in dem auf beiden Seiten Demokratien gegeneinander gekämpft hätten. Demokratien sind selten, sehr selten. Gerade mal 22 Länder auf der Welt gelten heute als voll funktionsfähige Demokratien. Wir haben Glück, in einer dieser Demokratien zu leben.
Aber Glück verpflichtet. Uns wird vertraut. Was machen wir mit diesem Vertrauen, nicht nur auf Reisen, sondern hier, im Alltag? Wie gestalten wir unsere Freiheit gegenüber anderen, die weniger stabil stehen? Denn der wahre Wert einer Demokratie zeigt sich nicht an der Grenze, sondern im Innern. Nicht nur, wie wir abstimmen, sondern wie wir miteinander umgehen.
Stellen Sie sich vor, ein Mensch verliert seine Arbeit. Sein Zuhause. Vielleicht wegen Krankheit oder einer Trennung, oder wegen einem Krieg. Und landet auf der Strasse. In einer funktionierenden Demokratie heisst das: Dieser Mensch wird nicht allein gelassen. Es gibt ein Netz. Es gibt Rechte. Es gibt Anlaufstellen. Nicht, weil jemand alles richtig gemacht hat, sondern weil er Mensch ist. Das ist der Kern. Oder in den Worten der Bundesverfassung:
Die Würde des Menschen ist zu achten und zu schützen: Artikel 7.
Und ja, das ist anstrengend! Demokratie heisst: Wir müssen uns aushalten – auch dann, wenn wir uns nerven. Wir nehmen Rücksicht aufeinander. Wie in einer Familie. Man wählt sich nicht gegenseitig aus, aber man gehört zusammen.
Oder wie im Wald, bei den Pilzen. Sie leben in Symbiose mit Bäumen: Beide geben, beide nehmen. Der eine versorgt den anderen mit Wasser, der andere mit Zucker. Aber nur solange das Gleichgewicht stimmt, funktioniert das Ganze. Auch unsere Gesellschaft lebt von solchen Gleichgewichten. Von Rücksicht und Gegenseitigkeit. Vom Ausgleich zwischen Freiheit und Verantwortung, zwischen Eigeninteresse und Gemeinwohl.
Wir leben in einem Land, das sich gerne als bescheiden versteht: Ein kleines Land, mit Bergen und Kühen, mit Konsens und Volksentscheiden, mit Neutralität und Anstand. Und vieles davon stimmt. Aber wir leben auch in einem Land mit sehr hohem Energie- und Ressourcenverbrauch.
Einem Land, das in vielerlei Hinsicht über seine Verhältnisse lebt – oder, genauer gesagt: über die Verhältnisse anderer. Denn was wir konsumieren, wird oft anderswo produziert.
Und gerade heute merken wir: Das bleibt nicht ohne Folgen.
Der «Zollhammer» der USA (fast 40 % auf Schweizer Produkte) zeigt: Auch wir stehen nicht ausserhalb der Welt. (Obwohl ich sicher bin, dass heute, am 1. August, wieder in der ganzen Schweiz Lobreden auf die Unabhängigkeit gehalten werden.) Der «Zollhammer» ist eine Erinnerung daran, wie eng Freiheit, Verantwortung und gegenseitige Abhängigkeit zusammenhängen.
Was wir verbrauchen, fehlt manchmal an anderen Orten. Was wir an CO₂ emittieren, wirkt weltweit, auch dort, wo Menschen deutlich weniger Möglichkeiten haben, sich zu schützen. Haben Sie gewusst, dass wir Abfall-Weltmeister sind? In den 70ern haben wir pro Kopf rund 300 kg Hausmüll produziert – heute sind es über 700 kg. Der EU-Schnitt? Rund 500kg. Ja, wir rühmen uns gerne für unsere Recyclingquote: Ja, recyceln können wir, aber wegwerfen besser.
Diese Dissonanz zwischen dem Bild der bescheidenen Schweiz, das wir von uns selbst haben oder gerne hätten, und der Realität unserer verschwenderischen Lebensweise ist nicht einfach ein moralisches Problem: Sie ist eine Herausforderung für unsere Demokratie. Denn Demokratie lebt nicht nur vom Recht auf Mitbestimmung und die Privilegien der Freiheit, sondern auch von der Pflicht zur gemeinsamen Verantwortung. Demokratie heisst nicht nur Freiheit, sondern auch Mass halten. Mass im Ton. Mass im Ego. Mass in der Macht. Und ja, auch Mass im Konsum. Nicht alles, was möglich ist, ist auch notwendig oder sinnvoll.
Ein gutes Leben hängt nicht vom maximalen Konsum ab. Die Ressourcen sind begrenzt, wir teilen mit anderen Menschen und Generationen. Wer in einem Land wie der Schweiz lebt, hat die Möglichkeit, über das eigene Handeln hinauszudenken. Nicht, weil wir besser sind, sondern weil wir es uns leisten können, Mass zu halten. Vielleicht besteht Fortschritt künftig nicht mehr nur im Mehr, sondern im Weniger? Die viel zelebrierte Eigenverantwortung darf nicht Gleichgültigkeit heissen.
Wenn uns alles jederzeit zur Verfügung steht, droht auch die politische Aufmerksamkeit zu sinken. Warum noch mitdenken, wenn man alles hat? Doch genau da beginnt die Gefahr für die Demokratie. Denn die Demokratie lebt davon, dass wir uns immer wieder frage: Dient das, was ich tue – oder lasse – dem Gemeinwohl? «Salus publica suprema lex esto». Steht beim Aufgang im Bundeshaus. Das Gemeinwohl steht über allem. Manchmal habe ich das Gefühl, das geht vergessen.
Aber: Ich sehe viele Menschen, die sich kümmern. In der Nachbarschaft. Im Verein. In der Schule. In der Gemeinde. Menschen, die Verantwortung nicht als Last sehen – sondern als Chance, wirksam zu sein. Gerade junge Menschen stellen heute Fragen, die früher kaum gestellt wurden: Was ist genug? Was ist fair? Was ist nachhaltig? Das ist ein gutes Zeichen. Denn genau darin zeigt sich, ob eine Demokratie lebendig ist: Ob sie Fragen aushält. Und ob sie auf die Zukunft antworten will – nicht nur auf die Vergangenheit.
A propos Zukunft: Ich sehe heute viele Kinder hier, und viele Eltern. Und ich bin sicher, dass Sie mit mir die Ansicht ein Stück weit teilen, dass es eine Herausforderung ist in der Erziehung damit umzugehen. Manchmal frage ich mich: Wie erklären wir unseren Kindern, was Verantwortung ist, in einer Welt, in der alles immer verfügbar scheint? Wenn unser Gesellschaftsmodell auf Konsum basiert, deren Konsequenzen wir unsichtbar outgesourct haben? Auch das hat mit Demokratie zu tun: In einer Demokratie haben wir nicht nur Rechte, sondern auch eine Pflicht zur Mitgestaltung. Demokratie heisst nicht nur abstimmen, sondern auch mitdenken. Verantwortung übernehmen. Auch als Eltern. Und: sich nicht einfach rausnehmen, wenns kompliziert wird.
Demokratie braucht Aufmerksamkeit. Mass – und vielleicht auch ein bisschen Demut. Oder um beim Pilz zu bleiben:
Manchmal ist das, was wunderbar duftet und überall wächst, ungeniessbar. Die wahren Schätze brauchen Zeit und gute Bedingungen. Sie wachsen gut versteckt. Leise. Im Netzwerk. Nicht für sich allein.
Demokratie ist ist ein wachsendes Wesen. Sie lebt von Beteiligung. Von Haltung. Von Respekt.
Und von Menschen, die nicht nur zuschauen, sondern mittragen. Vielleicht denken Sie an diese Worte, wenn Sie das nächste Mal einen Pilz sehen. Oder ein Abstimmungscouvert in der Hand halten. Ich danke Ihnen herzlich.
Liebe Wetzikerinnen, liebe Wetziker: Und wünsche Ihnen einen wunderschönen Bundesfeiertag – und alles Gute für die Zukunft, die wir gemeinsam gestalten können.